Leichte Sprache von Maurice Klauenberg
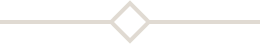
Kommunikation:
Verstehen, Anwenden, Fördern
Warum Kommunikation so wichtig ist
Kommunikation ist die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander – im Alltag, in der Arbeit und in sozialen Kontexten. Doch Kommunikation gelingt nur dann, wenn alle Gesprächspartner nicht nur die gleiche Sprache, sondern auch das gleiche Verständnis von Begriffen und Inhalten haben. Insbesondere in der sozialen Arbeit sind sprachliche Barrieren oder komplexe Fachbegriffe oft Hindernisse für eine effektive Verständigung. Um für diese Problematik zu sensibilisieren, werden nachfolgend Beispiele in Form von drei Slidern präsentiert.
Verstehen Sie die Sprache und den Inhalt?
Verstehen Sie den Inhalt und können diesen Anwenden?
Verstehen und Fördern
Kommunikation als Basis des Miteinanders
Wie Sie sicherlich gemerkt haben, gelingt echte Verständigung nur, wenn alle Gesprächspartner die gleichen Begriffe und Konzepte kennen und diese in entsprechender Zeit verarbeiten können. Dies ist jedoch oft nicht der Fall.
Kommunikation bildet die fundamentale Basis für jedes Miteinander und jede Form der Zusammenarbeit. Sie ist unverzichtbar und allgegenwärtig – „wir können nicht nicht kommunizieren“, wie der Psychologe Paul Watzlawick treffend formulierte. Kommunikation ist der Prozess, durch den wir unsere Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken und mit anderen teilen. Doch effektive Kommunikation gelingt nur, wenn die Beteiligten ein gemeinsames Verständnis von den verwendeten Begriffen und Konzepten haben. Ein Gespräch ist nur dann wirklich erfolgreich, wenn der Wortschatz und das Wissen der Gesprächspartner übereinstimmen.
Gemeinsamer Wortschatz und Fachkenntnisse
Im beruflichen Kontext, insbesondere in spezialisierten Bereichen, spielt der Wortschatz eine zentrale Rolle. Begriffe und Fachtermini sind oft nur für bestimmte Personengruppen verständlich, die über das notwendige Wissen oder die entsprechende Ausbildung verfügen. Beispielsweise sollte jede Führungskraft betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse besitzen und mit Begriffen wie Umsatz, Gewinn, innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Soll und Haben, Betriebsabrechnungsbogen (BAB), Abschreibungen (AfA) oder Return on Investment (ROI) vertraut sein. Diese Begriffe sind im Unternehmenskontext essenziell und werden in der Regel von Führungskräften vorausgesetzt, sind jedoch selbst im oberen Management nicht immer gegeben.
Andererseits ist es in einem Sozialunternehmen oder in der sozialen Arbeit nicht selbstverständlich, dass eine Geschäftsführung oder Bereichsleitung mit spezifischen Fachbegriffen aus der Informatik wie API (Application Programming Interface), IDE (Integrated Development Environment), GPU (Graphics Processing Unit) oder CPU (Central Processing Unit) vertraut ist – Begriffe, die bspw. für Informatikerinnen und Informatiker grundlegendes Wissen darstellen.
Die Herausforderung der Kommunikation in verschiedenen Kontexten
Kein Mensch kann alle Wörter und deren Bedeutungen vollständig erfassen und korrekt anwenden. Gerade im Bereich der sozialen Arbeit, wo häufig Menschen mit unterschiedlichen kognitiven und sozialen Hintergründen zusammenarbeiten, ist es besonders wichtig, sich der Kommunikation auf Augenhöhe zu bedienen. Wir müssen uns bewusst machen, dass nicht jeder die gleichen Fähigkeiten oder das gleiche Wissen mitbringt, um einem Gespräch zu folgen. Besonders bei Menschen mit eingeschränkter Kognition oder in Situationen, in denen komplexe Informationen vermittelt werden, kann es zu Missverständnissen kommen. Wie können wir erwarten, dass diese Menschen uns folgen oder unsere Intentionen verstehen, wenn die Kommunikationsmittel nicht adäquat an ihren Stand angepasst sind?
Die Bedeutung des Berufs- und Identifikationsethos
Im beruflichen Alltag, besonders in sozialen Einrichtungen, sollte es ein wesentlicher Bestandteil des Berufs- und Identifikationsethos sein, die bestmögliche Kommunikation zu ermöglichen und die Potenziale aller Beteiligten zu fördern. „Du kannst die Welt nicht retten“, ist ein oft zitierter Leitsatz unter bereits resignierten Kollegen in vielen sozialen Berufen, der durch die Schier von Sparmaßnahmen geprägt ist und das Personal zu Mitarbeitenden „Arbeit nach Vorschrift“ transformiert hat. Doch die Forderung nach Sparmaßnahmen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in vielen sozialen Einrichtungen inakzeptable Ressourcenverschwendungen stattfinden. Mieträume, die jahrelang ungenutzt bleiben, Projekte, die ohne konkreten Analysen finanziert werden oder Meetings ohne terminierte Zielvereinbarungen sind Beispiele für Missstände. Gleichzeitig fehlen jedoch die finanziellen Mittel für das, was die Daseinsberechtigung vieler sozialer Organisationen ausmacht – die direkte Unterstützung von Menschen (in Not). Hier sollte der Fokus auf einer verantwortungsvollen und zielgerichteten Ressourcennutzung liegen, die der eigentlichen Mission dient.
Sinne als Schlüssel zur effektiven Kommunikation
Kommunikation ist nicht nur auf verbale Ausdrucksweise beschränkt. Wir nehmen Informationen durch alle unsere Sinne auf, und diese multisensorische Wahrnehmung fördert das Verständnis und die Verankerung von Wissen. Besonders im sozialen Bereich, etwa in der Eingliederungshilfe oder Altenpflege, sollte es Ziel sein, mindestens zwei Sinne zur Kommunikation zu nutzen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Der Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmitteln wie Mimik, Gestik, Berührungen oder auch visuellen und auditiven Hilfsmitteln kann dazu beitragen, dass Informationen effektiver vermittelt und empfangen werden.
Das Aufrechterhalten von Wissen und Fähigkeiten
Wissen ist nicht statisch. Menschen lernen im Laufe ihres Lebens viele Dinge, die sie nicht immer dauerhaft anwenden oder benötigen. Zum Beispiel können Fremdsprachenkenntnisse oder mathematische Konzepte nach längerer Nichtnutzung stark verblassen. Wer über längere Zeit keine Englischkenntnisse anwendet, wird Schwierigkeiten haben, sich plötzlich in einem englischen Kontext zu orientieren. Ähnlich ist es mit kognitiven Fähigkeiten, die ohne regelmäßige Nutzung und Stimulation verloren gehen können. Der Prozess des „Aufrechterhaltens“ bezieht sich auf die Notwendigkeit, Wissen und Fähigkeiten durch kontinuierliche Wiederholung und Anwendung zu sichern und zu festigen.
Insbesondere im Alter oder bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen ist es entscheidend, dass ihre Fähigkeiten aktiv gepflegt und gefordert werden, um einen Abbau zu verhindern. Einrichtungen im sozialen Bereich sollten gezielt darauf ausgerichtet sein, durch verschiedene Kommunikationsmethoden und regelmäßige Stimulation der Sinne das kognitive Potenzial der betreuten Personen zu fördern und zu erhalten.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kommunikation mehr ist als nur das gesprochene Wort. Sie erfordert ein gemeinsames Verständnis, einen passenden Wortschatz und die Fähigkeit, Informationen über verschiedene Kanäle zu vermitteln und zu empfangen. Besonders in sozialen Einrichtungen ist es von großer Bedeutung, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und durch eine ganzheitliche Ansprache aller Sinne das Verständnis zu fördern. Nur so kann eine erfolgreiche und inklusive Kommunikation gewährleistet werden, die alle Beteiligten in ihrer Vielfalt berücksichtigt und respektiert.
